244 CD / The Welte Mignon Mystery Vol. XXIII. Ferrucio Busoni
Beschreibung
Zum letzten Mal tauchen wir im Rahmen unserer maßstabsetzenden Sammlung von Welte-Aufnahmen tief in das 19. Jahrhundert ein.
Der 1866 geborene Pianist und Komponist Ferruccio Busoni wurde bereits als Student von Johannes Brahms empfohlen und war bekannt mit zahllosen Musikern von Grieg bis Tschaikowsky. Heute ist er vor allem durch seine Bearbeitungen bzw. Interpretationen von Bach, Chopin und Liszt bekannt.
Sämtliche Welte-Einspielungen von Busoni finden sich auf dieser Doppel-CD (zum Preis von einer). Damit ist die TACET-Serie „The Welte Mignon Mystery“ abgeschlossen.
Video über das Welte Mignon Reproduktionsklavier mit dem Experten Hans W. Schmitz
4 Bewertungen für 244 CD / The Welte Mignon Mystery Vol. XXIII. Ferrucio Busoni
Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.





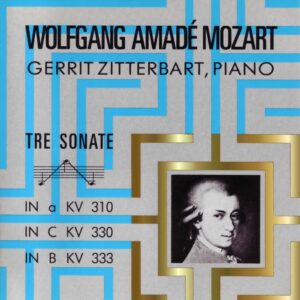
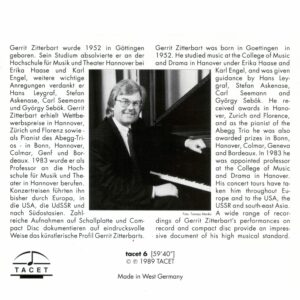
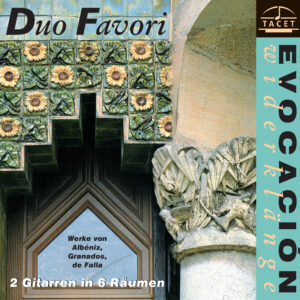
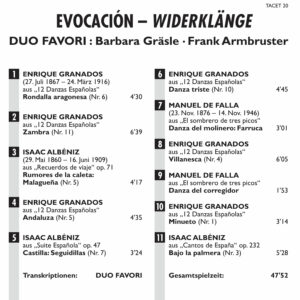


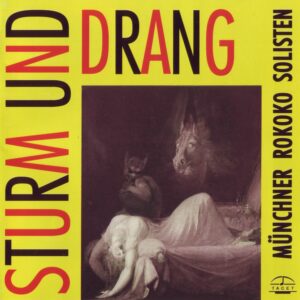
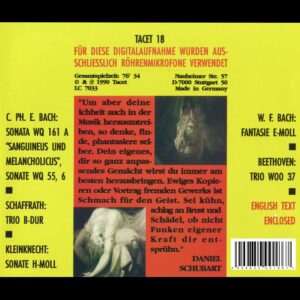

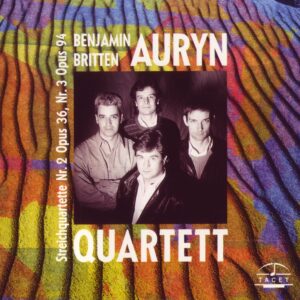
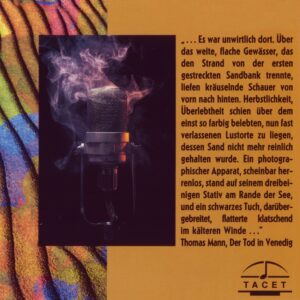
klassik.com –
–> zur Original-Kritik
Ganz ohne Rauschen: Busoni spielt 1905 und 1907 Chopin und Liszt.
Gramofon Ungarn –
[Die folgende Besprechung ist eine automatische Übersetzung der ungarischen Original-Kritik, das Original in ungarischer Sprache folgt unten.]
Das deutsche Plattenlabel Tacet veröffentlicht eine spannende Serie ehemaliger Welte-Mingon-Klavierrollenaufnahmen. Die neueste Veröffentlichung sind die Aufnahmen von Ferruccio Busoni, auf deren Cover steht: „Heute spielt Busoni“. Und das ist wahr. Zum Teil.
Michael Welte begann in Vöhrenbach im Schwarzwald mit der Herstellung von Orchestrien“, Musikinstrumenten auf der Basis von Pfeifen, Schlagwerk und manchmal auch Klavieren. 1872 zog die Fabrik nach Freiburg im Breisgau um. Der älteste Sohn von Michael Welte, Emil, zog 1865 in die Vereinigten Staaten und erfand die Klavierrolle. Eine Reihe von Patenten führte 1904 zur Einführung des Reproduktionsklaviers: Es spielte nicht nur die Noten, sondern reproduzierte auch das Tempo, die Phrasierung, die Dynamik und die Pedalbetätigung – mit einigen Einschränkungen. Mit einer gewissen Straffung, denn dadurch wurde die dynamische Skala etwas zur Mitte hin verschoben und die dynamischen Unterschiede zwischen den Händen wurden angeglichen. Debussy nahm seine vierzehn Stücke im November 1913 auf und schrieb an Edwin Welte: „Es ist unmöglich, eine vollkommenere Wiedergabe als die Welte zu erreichen. Ich freue mich, Ihnen mit diesen Zeilen meine Überraschung und Bewunderung über das Gehörte zu versichern.“
Was damals galt, gilt heute nur noch teilweise. Welte-Mignon-Rollenklaviere waren sowohl in Europa als auch in Amerika sehr beliebt und haben das Spiel vieler großer Komponisten und Interpreten geprägt. Die Technik überlebte den Ersten Weltkrieg, wurde aber durch die Weltwirtschaftskrise von 1929-33 und die elektronische Aufzeichnungstechnik schnell in den Hintergrund gedrängt. So sehr, dass die Spielgeräte, die Vorsetzer, allesamt zerstört wurden und erst viel später wieder aufgebaut wurden. Mehrere Verlage brachten daraufhin Compact-Disc-Rekonstruktionen dieser alten Dokumente auf modernem Klavier heraus. Die Firma Tacet begann eine Serie von Welte-Mignok-Rollen, die inzwischen zu einer umfangreichen Sammlung geworden ist. Vielleicht werden sie später zu Ampico-Rollen wechseln, was wichtig wäre, da Rachmaninoff bei dieser Firma unter Vertrag war. Deshalb ist er auf der Rachmaninoff-Scheibe von Tacet nicht zu hören, aber die Aufnahme der ersten Fassung der Sonate Nr. 2 mit Paul Strecker ist sehr interessant. […] Er ist ein deutscher Pianist und berühmter Lehrer, […], mit einem sehr puritanischen Stil, ziemlich weit vom Komponisten entfernt, als ob Rachmaninoff von der neuen Welt der Objektivität erfasst worden wäre.
Die Veröffentlichung von Busoni ist sehr interessant. Heutzutage werden hauptsächlich seine Bach-Transkriptionen aufgeführt. Davon ist nur das Choralvorspiel Nun freut euch, lieben Christen g’mein auf dem Album enthalten. Dann Chopin und vor allem Liszt. Wie hat Busoni das Klavier gespielt? Ja und nein. Natürlich nicht in seiner Gesamtheit, da das Grundwissen und das Grundhören unterschiedlich sind, und der Vorsetzer und das Instrument sowie die Akustik unterschiedlich sind, auch wenn das Ziel die Wiedergabetreue ist. Diese Veröffentlichungen sind klanglich sehr steril, als würden sie in einem leeren Raum erklingen. Das ist logisch, denn es spielt ja eine Maschine.
Oder ist es nicht so? Nicht ganz, denn es kommt viel durch. Eines der Stücke aus Tacets Welte-Mignon Mystery-Reihe enthält Mahler, Reinecke und Grieg. Von besonderem Interesse ist natürlich Mahler, der die Symphonie Nr. V, Satz I, und die Symphonie Nr. IV sowie Ging heut morgen übers Feld, Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald spielt. Mahlers klarer Rhythmus und kristallklare Strukturierung kommen absolut durch.
Auch bei Busoni hören wir deutlich das frühere, viel weichere und freiere Spiel als heute. Im Gegensatz zu vielen Virtuosen seiner Zeit ist er nicht übermäßig frei, sondern bevorzugt im allgemeinen Geschmack der späteren Jahre und unserer Zeit eine weniger kontrastreiche, wesentlich weichere und melodischere Verdichtung.
Heute erscheinen Busonis Bach-Transkriptionen im Vergleich zum Barock stark, und diejenigen, die sie spielen, neigen dazu, sie in einer Weise aufzuführen, die dem späteren festen Klangbild des großen Romantikers angepasst ist. Busoni hat dies nicht getan, und es ist anzumerken, dass der Klang, der heute aus vielen Gründen mit der großen Romantik in Verbindung gebracht wird, früher nicht so war. Dies spiegelt sich auch in Busonis Spiel wider, das eher von Süße und Leichtigkeit geprägt ist. Der Anfang von Liszts Polonaise Nr. 2 ist ein gutes Beispiel dafür. Heute spielen alle viel energischer. Ebenso lohnt es sich, über La Campanella nachzudenken. Wenn es eine Leistung gibt, die hervorzuheben ist, dann ist es zweifellos die von Cziffra. Viele Interpreten der letzten Jahrzehnte haben sich mit den Schwierigkeiten des Stücks schwer getan. Busoni ist vielleicht langsamer als sie alle, aber es ist nicht so, dass wir nicht das Gefühl hätten, dass er schneller fahren könnte, sondern dass wir uns in einer anderen Welt befinden. Es ist, als würde man ein Gemälde aus dem 19. Jahrhundert betrachten, und wo heute alles zugebaut ist, ist es weitgehend offene Natur mit wenigen Gebäuden. Der Kontrast ist anders, die Wirkung der Akzente ist anders, die Welt ist anders.
In diese völlig andere Welt entführt die ausgezeichnete Serie von Tacet. Die gegenwärtigen Stimmen der Vergangenheit sind sicherlich relevant, sie erzählen viel, aber sie geben nicht alles wieder. Manchmal brauchen sie mehr, manchmal weniger Nuancierung und Relativierung. Ich bezweifle zum Beispiel, dass Grieg das Klavier mit einem so kiesigen Klang gespielt hat, ich denke, dass das Pedal des Instruments von damals und das von heute nicht dasselbe ist, und dass das, was er gespielt hat, romantischer klang. Der typische Ansatz eines Komponisten ist jedoch ein reiner Rhythmus und eine tonale Bildsprache. Mahlers schwungvolles Spiel ist logischer. Wir wissen nicht genau, wie er gewesen sein könnte, aber das ist auch nicht so wichtig, denn bei seinen Orchestersätzen und Liedern dominieren auf jeden Fall die straffen Rhythmen.
Ich für meinen Teil schätze Felix Mottl sehr, an den man sich normalerweise nicht erinnert, obwohl er die Wesendonck-Lieder in ein Orchestergewand gekleidet hat. Sein Material umfasst Wagner-Ouvertüren und Orchesterauszüge, und sein weiches, melodisches und entspanntes Spiel ist auffällig und sehr wichtig. Dies ist sicherlich eine erwägenswerte Ergänzung, da sie ein anderes Bild von Wagner vermittelt. Hinzu kommen die frühesten relevanten Wagner-Aufnahmen, wie Karl Elmendorffs Aufnahme von Tristan und Isolde in Bayreuth aus dem Jahr 1928 mit Nanny Larsén-Todsen und Gunnar Graarud in den Hauptrollen. Mottls Klavierzwischenspiele und dieses hier ergänzen und verstärken sich gegenseitig.
Wie hat Busoni das Klavier gespielt? Besser bekannt durch die Aufnahmen, bequemer als in späteren Zeiten, entspannter, weicher, mit mehr Andeutungen von Stimmung. Auch das Programm ist kein Zufall; aus verständlichen Gründen wurde zu seiner Zeit mehr Wert auf kürzere Stücke und Opernparaphrasen gelegt.
Balázs Zay
_________________________________________
A német Tacet lemezkiadó izgalmas sorozatot jelentet meg a Welte-Mingon cég egykori zongoratekercs-felvételeiből. Legutóbb Ferruccio Busoni felvételeinek kiadására került sor. A borító szerint „ma játszik“ Busoni. És ez igaz is. Részben.
Michael Welte a Fekete-erdei Vöhrenbachban kezdett „orkesztrionokat“, sípokra, ütőkre és néha zongorára is épülő zenegépeket gyártani. 1872-ben a breisgaui Freiburgba költözött a gyár. Michael Welte idősebb fia, Emil 1865-ben az Egyesült Államokra költözött, ő találta fel a zongoratekercset. Szabadalmak sora vezetett a reprodukciós zongora 1904-es bevezetéséhez: ez már nemcsak a hangokat játszotta le, hanem visszaadta a tempót, a frazeálást, a dinamikát, a pedálhasználatot is – némi megszorítással. Némi megszorítással, mert a dinamikai skála szélei felől valamelyest közép felé tolt, továbbá a kezeken belüli dinamikai eltéréseket egy szintre hozta. Debussy 1913 novemberében játszotta fel tizennégy darabját, majd ezt írta Edwin Weltének: „A Welte-készüléknél tökéletesebb reprodukciót elérni lehetetlen. Örömmel biztosíthatom e sorokkal meglepetésemről és csodálatomról a hallottakat illetően.“
Ami akkor igaz volt, ma csak részben az. A Welte-Mignon tekercsekkel működő gépzongorák mind Európában, mind Amerikában nagy népszerűségnek örvendtek, s számos jeles zeneszerző és előadó játékát örökítették meg. Az I. világháborút túlélte a technika, de az 1929-33-as gazdasági világválság és az elektronikus felvételi technika aztán gyorsan háttérbe szorította. Annyira, hogy a lejátszók, a Vorsätzerek mind el is pusztultak, ezeket jóval később kezdték újraépíteni. Több kiadó jelentette meg aztán kompaktlemezen is e régi dokumentumok rekonstrukcióit modern zongorán. A Tacet cég a Welte-Mignok tekercsekből indított – mára gazdaggá vált – sorozatot. Talán később az Ampico-tekercsekre is áttérnek, ez azért lenne fontos, mert Rahmanyinov ezzel a céggel állt szerződésben. Ezért a Tacet Rahmanyinov-lemezén ő nem játszik, roppant érdekes azonban a II. szonáta első változatának felvétele Paul Streckerrel. Ki is ő? Nem a festő. Egy nála idősebb német zongorista és híres tanár, nagyon puritán, a zeneszerzőtől éppenséggel eléggé távoli stílussal, mintha Rahmanyinovot az új tárgyilagosság világa kebelezte volna be.
A Busoni-kiadvány igen érdekes. Napjainkban főképp Bach-átiratai hangzanak el. Ezek közül mindössze a Nun freut euch, lieben Christen g’mein korálelőjáték kapott helyet az albumon. Utána Chopin és főképp Liszt. Megtudjuk, hogyan zongorázott Busoni? Igen is, nem is. A maga teljességében nyilván nem, hiszen más az alapismeret és alaphallás, a hűségre törekvés mellett is más a Vorsätzer és a hangszer, valamint az akusztika. Ezek a kiadványok igen sterilek hangzás terén, mintha üres térben szólalnának meg. Ez logikus is, hiszen gép játszik.
Vagy mégsem? Nem teljesen, mert azért sok minden átjön. A Tacet Welte-Mignon Mystery sorozatának egyik darabján Mahler, Reinecke és Grieg játszik. Nyilván különösen Mahler érdekes, aki az V. szimfónia I. és a IV. szimfónia IV. tételét játssza, valamint a Ging heut morgen übers Feld -t, az Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald-t. Abszolút átjön Mahler határozott ritmikája, kristálytiszta strukturálása.
Busoni esetében is egyértelműen halljuk a hajdani, a mainál sokkal lágyabb és szabadabb játékot. Ő – sok egykorú virtuóztól eltérően – nem túlságosan szabad, de a későbbiek és napjaink általános ízlése szerint kevésbé kontrasztra törekvő, alapjában véve lágyabb és dallamosabb összenyomást preferál.
Ma Busoni Bach-átiratai a barokkhoz képest erősnek tűnnek, s akik játsszák, általában a nagyromantika később rögzült hangzásképéhez igazítva adják elő. Busoni nem így tett, s meg kell jegyezni, hogy az a hangzás, ami sok okból kifolyólag ma a nagyromantikához társul, egykor nem ilyen volt. S ezt tükrözi Busoni játéka, melyben több a kedélyesség, a könnyedség. Jó példa Liszt II. polonézének eleje. Ezt ma mindenki sokkal erőteljesebben játssza. Ugyanígy érdemes elgondolkodni a La Campanellán. Nem kérdés, hogy ha egy előadást kell kiemelni, az mindenképp Cziffráé. Az elmúlt sok évtized előadói közt sokan küzdenek a darab nehézségeivel. Busoni talán mindnél lassabb, de nem azt érezzük, hogy nem menne gyorsabban, hanem azt, hogy egy másik világban vagyunk. Olyan ez, mint amikor egy XIX. századi festmény látunk, és ahol most minden be van építve, nagyrészt szabad természet szerepel, kevés épülettel. Más a kontraszt, más az akcentusok hatása, eltérő a világ.
Ebbe a teljesen más világba visz vissza a Tacet kiváló sorozata. Az egykori bejátszások mai megszólalásai mindenképp relevánsak, elárulnak sok mindent, de nem adnak vissza mindent. Néha több, néha kevesebb árnyalás, relativizálás szükséges hozzájuk. Kétlem például, hogy Grieg ennyire szikár hangon zongorázott, szerintem az egykori hangszer és mai pedálja nem azonos, s amit játszott, romantikusabban szólt. Ugyanakkor tipikus zeneszerzői megközelítés a tiszta ritmizálás és hangzáskép. Mahlernél a peckes játék logikusabb. Nem tudjuk, milyen lehetett pontosan, de nem is fontos annyiban, hogy zenekari tételeket és dalokat ad elő, mindenesetre a feszes ritmika mindenképp domináns jellegzetesség.
A magam részéről sokra tartom Felix Mottlt, akiről nem szokás megemlékezni, pedig ő öltöztette zenekari köpenybe a Wesendonck-dalokat. Az ő anyaga Wagner-nyitányokat és zenekari részleteket tartalmaz, feltűnő és igen fontos, hogy milyen lágyan és dallamosan, s milyen nyugodtan játszik. Ez mindenképp megfontolandó adalék, hiszen egy másfajta Wagner-képet közvetít. Ehhez érdemes hozzátenni a legkorábbi releváns Wagner-bejátszásokat, például Karl Elmendorff 1928-ból származó bayreuthi Trisztán és Izolda-felvételét, amelyben Nanny Larsén-Todsen és Gunnar Graarud énekelte a főszerepeket. Mottl zongorás bejátszásai és ez kiegészítik, erősítik egymást.
Hogyan zongorázott Busoni? A lemezfelvételek révén jobban ismert, későbbi időktől eltérően kényelmesebben, nyugodtabban, lágyabban, több hangulati utalással. Nem véletlen a műsor sem, érthető okból hajdanán nagyobb súly esett a rövidebb darabokra, valamint az operaparafrázisokra.
Zay Balázs
Klassik heute –
–> zur Original-Kritik
Mit der vorliegenden 23. Folge endet die große, 2004 begonnene Welte-Mignon-Edition des Labels Tacet, die zahlreiche hochinteressante Interpretationen von Pianisten und Komponisten des frühen 20. Jahrhunderts neu restauriert und in exzellenter Klangqualität am Steinway-Flügel gespielt zugänglich gemacht hat. In aller Kürze sei an dieser Stelle noch einmal das Grundprinzip umrissen: bei einem Welte-Mignon-Reproduktionsklavier wurde das Spiel eines Pianisten (inklusive dynamischer Feinheiten, Pedalverwendung etc.) auf gelochten Papierbändern gebannt, auf Basis derer dann die Interpretation mechanisch, aber eben inklusive nahezu aller Details wiedergegeben werden konnte, ein Musikautomat also, der das Spiel eines Pianisten weitgehend originalgetreu reproduzieren konnte. Insgesamt wurden mehrere Tausend solcher Aufnahmen produziert, die heute einen ganz faszinierenden (rauschfreien) Einblick in das Klavierspiel vor über 100 Jahren liefern.
Intellektuelles Klavierspiel und die Tradition des 19. Jahrhunderts
Bei der letzten Folge, die zwei CDs umfasst, handelt es sich noch einmal um einen echten Höhepunkt, nämlich um Aufnahmen des großen Ferruccio Busoni (1866–1924), der bekanntlich nicht nur ein legendärer Klaviervirtuose war, sondern auch ein vorzüglicher Komponist, Musikessayist und Dirigent, ein wahrhaft universeller Musiker also. Auf dem Programm stehen neben dem vierten seiner Choralvorspiele nach Bach drei Stücke von Chopin und vor allem Musik von Franz Liszt, dessen Schaffen ein Fixpunkt von Busonis Repertoire war. Busoni galt als intellektueller, sachlicher Pianist, kein Tastenlöwe, sondern ein Interpret, der die Strukturen der Musik betonte, nach Klarheit strebte, nicht Virtuosität, sondern das Werk selbst in den Vordergrund stellte. Dies bedeutet allerdings keineswegs, dass für ihn der Notentext unantastbar gewesen wäre (Exaktheit ist ohnehin sicherlich nicht das, was das Wesen dieser Interpretationen ausmacht – hier und da wird man auch gewisse rhythmische Unregelmäßigkeiten oder leicht „klappernde“ Akkorde feststellen); in dieser Hinsicht steht er wiederum klar in der Tradition des 19. Jahrhunderts.
All dies kann man anhand der vorliegenden Interpretation – im Juli 1905 und März 1907 entstanden – ziemlich gut nachvollziehen. In Chopins Regentropfen-Prélude op. 28 Nr. 15 etwa ergänzt Busoni im Moll des Mittelteils die linke Hand teilweise um Oktavierungen, was der Musik eine bedrohliche Aura, eine ganz eigentümliche Schwere verleiht. Natürlich ist dies im historischen Kontext zu betrachten, aber es wäre verfehlt, darüber lediglich zu lächeln. Tatsächlich begriff Busoni Chopins 24 Préludes offenbar in erster Linie als Zyklus, in welchem das fünfzehnte als Achse fungierte, d.h. hier geht es weniger um einen Effekt als vielmehr um ein Mehr an Bedeutung; die Interpretation ergibt sich aus seiner Wahrnehmung des Gesamtwerks, selbst wenn dies mit Mitteln geschieht, zu denen man heute nicht mehr greift. Seine Einspielung von Chopins As-Dur-Polonaise op. 53 wirkt dagegen eher zurückgenommen, gebremst.
Meisterhaftes Gestalten großer Zusammenhänge
Wie bereits erwähnt, war es Liszts Musik, für die sich Busoni ganz besonders interessierte, und einige dieser Interpretationen sind wahre Sternstunden, exemplarisch vielleicht die der Norma-Fantasie. Hier zeigt sich, was Busonis Kunst wirklich ausmacht, und das ist speziell sein Sinn für das Gestalten großer Zusammenhänge, seine Fähigkeit, die Dramaturgie der Musik hervortreten zu lassen: zu jedem Zeitpunkt weiß man genau, wo (im Verlauf des Stücks) man sich gerade befindet, Busonis Gespür für die „Richtung“ der Musik ist exorbitant. Dabei ist sein Spiel orchestral, reich an Klangfarben und Nuancen, souverän darin, dem Melos zu folgen, die Harmonien auszuhören, die Liszt’sche Ornamentik als Farbgebung zu betrachten, ohne sie aber derart in den Vordergrund zu rücken, dass sie die Musik erdrückt. Bemerkenswert ist zudem, dass der immense Sog, den Busoni (speziell gegen den Schluss hin) erzeugt, nicht dadurch entsteht, dass er sonderlich forcieren würde (das tut er hier eigentlich ebenso wenig wie in Chopins Polonaise), sondern dadurch, dass er extrem klug dosiert und disponiert, und so kann er es sich sogar leisten, den allerletzten Akkord wieder etwas abzuschwächen, ohne die Schlusswirkung im Mindesten zu gefährden. Allein für diese meisterhafte Interpretation lohnt sich bereits der Kauf der CD. Schade nur, dass von Busoni keine Interpretationen (noch) größer angelegter Werke überliefert sind.
Faszinierende Aufnahmen
Das Beiheft liefert neben einer Vorstellung des Welte-Mignon-Verfahrens eine gute Einordnung von Busoni, seinem Klavierspiel und den hier versammelten Interpretationen im Speziellen. Lediglich bei der Trackliste hätte man etwas mehr Sorgfalt walten lassen sollen: dass es sich nicht Chopins Polonaise „op. 53 Nr. 6“ handelt, ist ohnehin klar, aber auch im Falle von Liszts Mélodies hongroises nach Schubert hätte z.B. der Verweis darauf, dass man es hier nur mit dem Mittelsatz zu tun hat, nicht geschadet. Das soll aber einem faszinierenden Dokument historischen Klavierspiels und großen Musizierens keinen Abbruch tun.
Holger Sambale
Pizzicato –
–> Original-Kritik
Fast drei Jahre hatte Tacet keine neue Folge seiner Welte Mignon Mystery-Serie herausgebracht. Jetzt folgt ein Doppelalbum mit Ferruccio Busoni, der Musik von Bach, Chopin und Liszt spielt. Er hatte diese Welt-Mignon-Rollen 1905 und 1907 aufgenommen, die jetzt als historisches Dokument ohne historischen Klang zum Leben erweckt werden. Dabei sind vor allem Busonis Liszt-Interpretationen bemerkenswert, die seine erstaunlichen pianistischen Fähigkeiten zeigen. Vor allem für Pianisten, die Liszt mit Lautstärke verbinden, sind diese Aufnahmen beherzigenswerte Lehrstücke.
Remy Franck